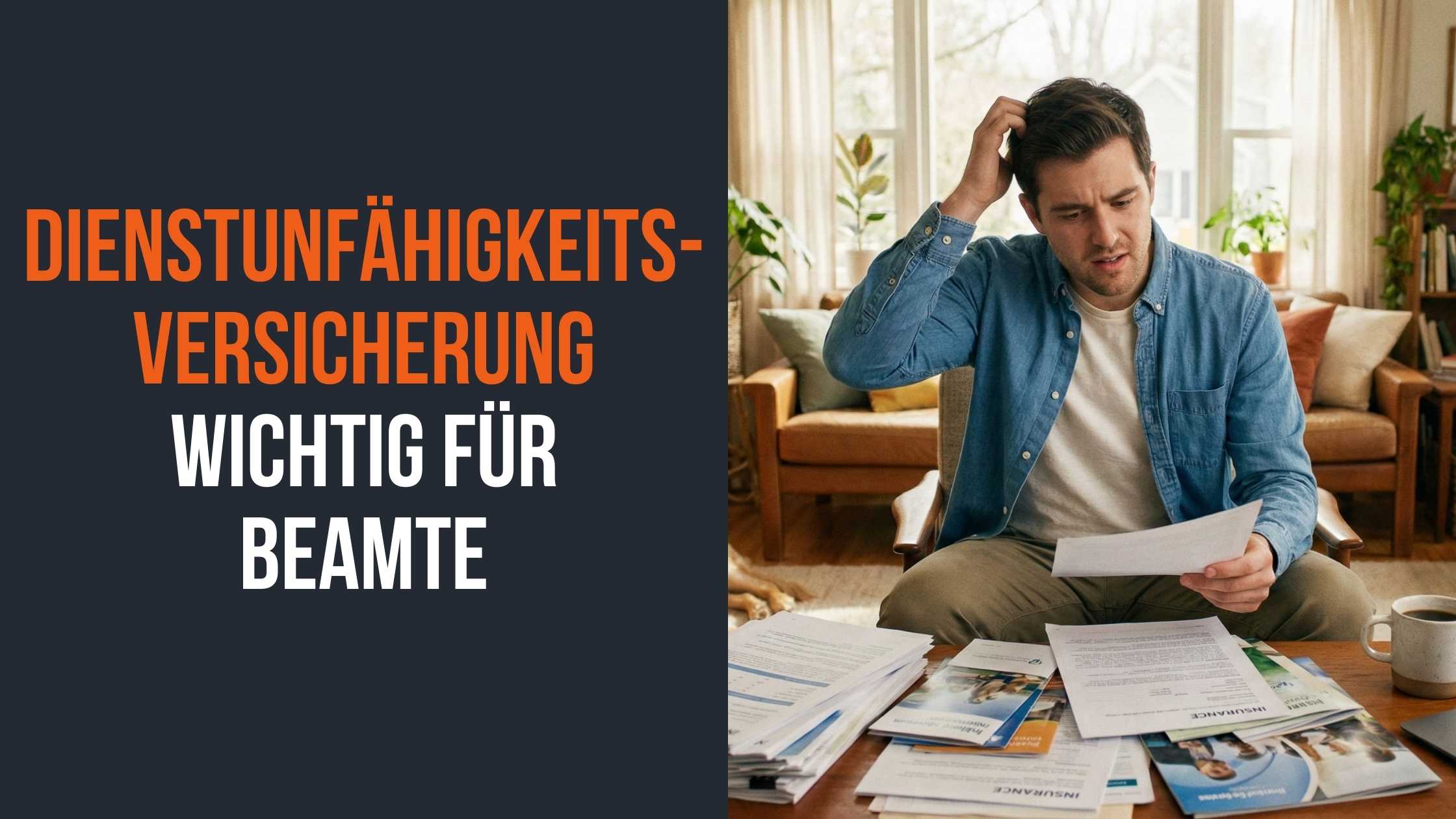Patientenakte und falsche Diagnosen: Warum sie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung zum Problem werden können
Die Patientenakte spielt eine entscheidende Rolle, wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) beantragst. Doch was viele nicht wissen: In der Akte stehen nicht nur gesicherte Diagnosen, sondern oft auch falsche, ungenaue oder veraltete Diagnosen, die erhebliche Folgen für deinen Versicherungsantrag haben können.
Doch wie entstehen solche Fehleinträge? Welche Arten von Diagnosen gibt es in einer Patientenakte? Und warum kann das deinen Versicherungsschutz gefährden? In diesem Artikel erfährst du alles Wichtige – und warum eine professionelle Beratung so wichtig ist.
Was ist die Patientenakte und welche Informationen enthält sie?
Die Patientenakte ist die offizielle Dokumentation deiner medizinischen Vorgeschichte. Ärzte, Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen sind verpflichtet, diese Akte zu führen.
Typischerweise enthält die Patientenakte:
- Diagnosen (gesicherte, Verdachts- oder Fehldiagnosen)
- Behandlungsverläufe und Arztberichte
- Medikamentenverordnungen
- Laborergebnisse und Bildgebungen (z. B. MRT, Röntgen)
- Therapieempfehlungen
Wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragst, kann der Versicherer diese Akte nutzen, um dein Gesundheitsrisiko zu bewerten. Das Problem: Nicht jede Diagnose in der Patientenakte ist korrekt oder medizinisch relevant.
Warum gibt es falsche Diagnosen in der Patientenakte?
Es gibt viele Gründe, warum deine Patientenakte Diagnosen enthalten kann, die nicht (mehr) zutreffen:
- Verdachtsdiagnosen wurden nie gelöscht: Eine Krankheit wurde vermutet, aber nie bestätigt – doch der Eintrag bleibt bestehen.
- Abrechnungsdiagnosen sind nur für die Krankenkasse relevant: Manche Diagnosen werden nur zur Abrechnung dokumentiert, obwohl sie medizinisch nicht notwendig sind.
- Fehldiagnosen durch Irrtümer: Ein Arzt interpretiert Symptome falsch oder trägt eine Diagnose zu schnell ein.
- Überholte Diagnosen: Eine frühere Erkrankung ist längst ausgeheilt, aber weiterhin in der Akte vermerkt.
- Scheindiagnosen und Gefälligkeitsdiagnosen: Eine Krankheit wird dokumentiert, obwohl sie eigentlich nicht vorliegt – oft aus wirtschaftlichen oder praktischen Gründen.
Diese Fehleinträge können bei einem BU-Antrag fatale Folgen haben. Versicherer bewerten nur die Diagnose, nicht den Kontext. Eine harmlose Fehldiagnose kann dich also risikoreicher erscheinen lassen, als du tatsächlich bist.
Welche Arten von Diagnosen gibt es in der Patientenakte?
Nicht jede Diagnose bedeutet, dass du wirklich an dieser Krankheit leidest. Hier sind einige typische Diagnosearten, die in der medizinischen Dokumentation auftauchen:
1. Verdachtsdiagnosen – Wenn eine Krankheit vermutet wird
Ein Arzt vermutet eine Erkrankung und trägt sie in die Akte ein, auch wenn sie später nicht bestätigt wird.
Beispiel: Du gehst mit Kopfschmerzen zum Arzt. Er vermutet eine Migräne und dokumentiert das in der Patientenakte. Später stellt sich heraus, dass es nur Verspannungen waren – doch die Diagnose „Migräne“ bleibt bestehen.
👉 Problem für die Berufsunfähigkeitsversicherung: Versicherer sehen nur „Migräne“, nicht, dass die Diagnose später nicht bestätigt wurde.
2. Abrechnungsdiagnosen – Wenn Diagnosen nur für die Krankenkasse gestellt werden
Ärzte müssen Diagnosen angeben, um Behandlungen mit der Krankenkasse abzurechnen. Diese Diagnosen sind oft nicht medizinisch notwendig, sondern erleichtern lediglich die Abrechnung.
Beispiel: Du hattest einmal Rückenschmerzen, doch für die Abrechnung mit der Krankenkasse wird „chronische Rückenschmerzen“ eingetragen.
👉 Problem für die Berufsunfähigkeitsversicherung: Chronische Rückenschmerzen sind eine Hauptursache für Berufsunfähigkeit – diese Diagnose könnte zu einer Ablehnung oder einem Risikozuschlag führen.
3. Verlegenheitsdiagnosen – Wenn Ärzte keine klare Antwort haben
Manchmal gibt es keine eindeutige Ursache für Beschwerden. Ärzte tragen dann eine Diagnose ein, die ungefähr passt, aber nicht zwingend korrekt ist.
Beispiel: Du hast wochenlang Magenschmerzen, aber alle Tests sind unauffällig. Dein Arzt trägt „Reizdarmsyndrom“ ein, weil keine andere Erklärung gefunden wird.
👉 Problem für die Berufsunfähigkeitsversicherung: Die Diagnose bleibt bestehen – auch wenn die Beschwerden längst verschwunden sind.
4. Scheindiagnosen – Wenn eine normale Befindlichkeit zur Krankheit gemacht wird
Eine Scheindiagnose entsteht, wenn eine eigentlich harmlose oder ungeklärte Befindlichkeit zur Krankheit erklärt wird.
Beispiele:
- Ein Patient fühlt sich oft müde, ohne medizinische Ursache. Der Arzt schreibt „chronisches Erschöpfungssyndrom“ in die Akte.
- Ein Kind ist lebhaft und bekommt die Diagnose „ADHS“, obwohl es nicht alle Kriterien erfüllt.
👉 Problem für die Berufsunfähigkeitsversicherung: Scheindiagnosen führen dazu, dass du als kränker giltst, als du tatsächlich bist.
5. Gefälligkeitsdiagnosen – Wenn Diagnosen aus Nettigkeit gestellt werden
Manchmal helfen Ärzte ihren Patienten mit Diagnosen, die nicht ganz der Realität entsprechen.
Beispiele:
- Ein Arzt schreibt eine Krankschreibung, weil der Patient ein paar Tage frei haben möchte.
- Ein Psychologe erstellt ein Gutachten über psychische Belastung, damit eine OP von der Krankenkasse übernommen wird.
👉 Problem für die Berufsunfähigkeitsversicherung: Diese Diagnosen bleiben in der Akte und können Jahre später Probleme machen.
Unterschätzte Gefahr: Vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung
Ein weiteres großes Risiko: Wenn du Diagnosen aus deiner Patientenakte nicht angibst oder nicht korrigieren lässt, kann das im Leistungsfall zum Verhängnis werden.
Wenn du berufsunfähig wirst, prüft der Versicherer, ob du bei Antragstellung alle relevanten Diagnosen korrekt angegeben hast. Falls nicht, kann er sich auf eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung berufen – das bedeutet, dass er die Leistung verweigern kann.
👉 Das heißt: Wenn du falsche Diagnosen nicht prüfst und angibst, riskierst du deinen Versicherungsschutz im Ernstfall.
Warum eine Expertenberatung entscheidend ist
Versicherer haben ein berechtigtes Interesse daran, das Risiko korrekt einzuschätzen. Wenn in deiner Patientenakte Fehldiagnosen stehen oder du unklare Unterlagen einfach einreichst, kann das dazu führen, dass du schlechtere Konditionen bekommst oder der Antrag abgelehnt wird.
Daher gilt: Niemals blind Unterlagen an die Versicherung weitergeben!
Eine professionelle Beratung hilft dir:
✅ Fehlerhafte Diagnosen in deiner Patientenakte zu erkennen
✅ Richtige Strategien für den BU-Antrag zu entwickeln
✅ Mit Ärzten zu sprechen, um Korrekturen vorzunehmen
✅ Den Versicherungsantrag so zu stellen, dass keine unnötigen Risiken entstehen
Falls du eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchtest oder unsicher bist, welche Diagnosen in deiner Patientenakte stehen, kann eine professionelle Beratung den entscheidenden Unterschied machen.
Ein großes Problem für viele Mandanten ist, dass nicht jeder Versicherungsvermittler sich wirklich tiefgehend mit Berufsunfähigkeitsversicherungen und den komplexen medizinischen Hintergründen auskennt. Die gesamte Thematik rund um die Patientenakte, falsche Diagnosen und die korrekte Risikoprüfung erfordert fundiertes Fachwissen.
Leider gibt es Vermittler, die entweder aus Unwissenheit oder aus wirtschaftlichem Interesse den Prozess nicht sorgfältig genug begleiten. Manche wollen den Vertragsabschluss möglichst schnell herbeiführen, ohne sich intensiv mit den individuellen Gesundheitsangaben auseinanderzusetzen. Das kann für dich als Mandanten schwerwiegende Folgen haben – von unnötigen Risikozuschlägen bis hin zur Ablehnung oder sogar dem Verlust deines Versicherungsschutzes im Leistungsfall.
Deshalb ist es essenziell, einen Experten an deiner Seite zu haben, der sich nicht nur mit den Tarifen der Versicherer auskennt, sondern auch mit den gesundheitlichen Anforderungen und den Fallstricken in der Risikoprüfung. Nur so kannst du sicherstellen, dass dein Antrag korrekt und strategisch klug gestellt wird – und du im Ernstfall auch wirklich abgesichert bist.
👉 Möchtest du sichergehen, dass deine Patientenakte keine unnötigen Risiken für deine Versicherung birgt? Dann lass dich von mir beraten! 😊